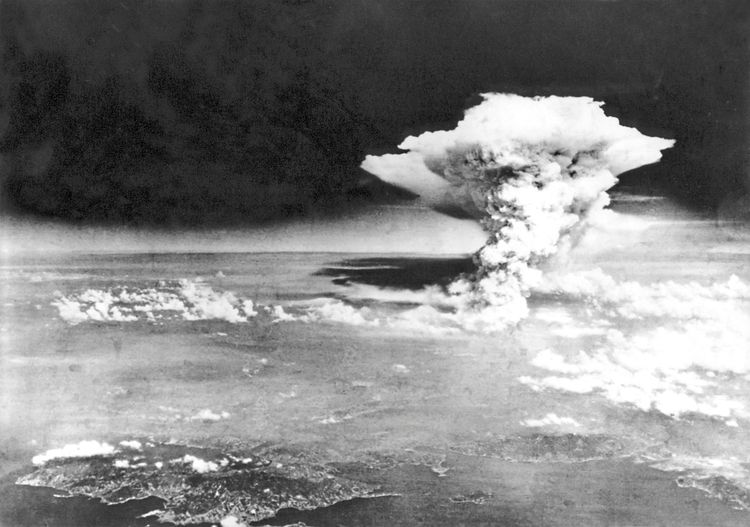Austro-brasilianischer Bischof in Interview mit Vorarlberger "Kirchenblatt": "Mein Platz ist am Xingu"
Kathpress, 29.08.2025 (KAP)
Nicht nur die Weltkirche, auch die Kirche in Amazonien braucht jenen Schwung, den Papst Franziskus der Kirche mit dem "Synodalen Prozess" verliehen hat: Das betonte der austro-brasilianische Bischof Erwin Kräutler in einem Interview im Vorarlberger "Kirchenblatt" (aktuelle Ausgabe). War die Kirche Amazoniens Ende der 1960er und bis in die 1980er Jahre hinein noch Vorreiter an Synodalität, so sei dies in manchen Bereichen "von einem neo-hierarchischen Prinzip" und Geistlichen mit "pentekostalistischer Ausrichtung" überschattet, wodurch Priester und Bischöfe plötzlich wieder fast uneingeschränkt autoritär wurden. "Es bleibt zu hoffen, dass die 'Synode zur Synodalität' nun doch eine Neubesinnung bewirkt" und der Kirche wieder "neuen synodalistischen Schwung verleiht", so Kräutler.
Anlass des Interviews bot der 60. Jahrestag der Priesterweihe des aus Vorarlberg stammenden Bischofs am 3. Juli 1965 im Salzburger Dom. Unmittelbar danach ging Kräutler Anfang November 1965 nach Brasilien, wo er seither lebt und seit 1980 auch als Bischof wirkt. Gerade die Erfahrungen der kirchlichen Aufbrüche in Lateinamerika Ende der 1960er Jahre mit den Bischofskonferenzen von Medellin (1968) und Puebla (1979) und später die "Erste Versammlung des Volkes Gottes am Xingu" (1984) hätten ihn tief geprägt: "Wir erlebten jedes Mal pur das, was man nun wieder Synodalität nennt, denn alle zusammen, gemeinsam, heute würden wir sagen synodalisch, erarbeiteten und beschlossen wir, nach einer Evaluation der vergangenen, die pastoralen Linien für die folgenden fünf Jahre."
Seine ganze Liebe gelte bis heute den Menschen am Xingu - auch wenn er seine Heimat Vorarlberg nicht vergesse: "Ich weiß längst, dass mein Platz hier am Xingu ist, im brasilianischen Amazonien", so der 86-jährige Kräutler. "Ich gehöre längst zu diesem Volk. (...) Nicht, dass ich meine Wurzeln vergessen hätte. Wenn ich im Ländle bin, spreche ich nach wie vor gerne Dialekt mit Urkoblacher Färbung! Ich fühle mich mit Kirche und Land Vorarlberg und Österreich über alle Jahrzehnte hinweg verbunden und bin dankbar für all die Rückendeckung, die ich seit 60 Jahren erhielt und immer noch erhalte. Aber meine Lebensaufgabe, zunächst als Priester und dann seit 1981 als Bischof, versuche ich hier zu erfüllen."
Sowohl Papst Franziskus als auch Papst Leo XIV. seien Geschenke für die Kirche speziell in Lateinamerika, erklärte Kräutler weiter. Mit der Amazoniensynode von 2019 und dem Synodalen Prozess habe Papst Franziskus nicht nur Kirchengeschichte geschrieben, insofern Frauen erstmals auf einer Synode Stimmrecht hatten - er habe mit der Amazoniensynode auch dafür gesorgt, dass die "Sorgen und Anliegen der Kirche in Amazonien" bekannt gemacht wurden. In einer ähnlichen Spur sieht Kräutler auch Papst Leo. Er stehe für ein besonderes Missionsverständnis, demnach sich nicht nur die Botschaft, sondern der Bote selbst "inkulturieren" müsse - in voller Offenheit und Bereitschaft, die Mitmenschen zu lieben.

Ich bin bis heute ein Lernender
Vor 60 Jahren wurde Bischof Erwin Kräutler (86) zum Priester geweiht. Im Gespräch erinnert er sich an besondere Momente seines Lebens.
Wie geht es Ihnen gesundheitlich?
Bischof Erwin Kräutler: Inzwischen bin ich schon 86 und kann dem lieben Gott für meine Gesundheit nur danken. Alles geht ein bisschen langsamer und längere Reisen auf unseren Straßen ermüden mich rasch, Flussreisen weniger. Aber ich bin auch nicht mehr so viel unterwegs wie früher.
Haben Sie Pläne nach Vorarlberg zurückzukehren?
Bischof Kräutler: Ich weiß längst, dass mein Platz hier am Xingu ist, im brasilianischen Amazonien. Wenige Monate nach meiner Priesterweihe am 3. Juli 1965 in Salzburg nahm ich Abschied von meiner Familie, von Koblach, vom Ländle und bin seither mit ein paar Unterbrechungen hier. Ich gehöre längst zu diesem Volk. Das sagen mir die Leute immer wieder. Gerade am Geburtstag und kurz zuvor bei meinem Weihejubiläum erfuhr ich wieder, wie mich die Menschen hier mögen und „verwöhnen“. Nicht, dass ich meine Wurzeln vergessen hätte. Wenn ich im Ländle bin, spreche ich nach wie vor gerne Dialekt mit Urkoblacher Färbung! Ich fühle mich mit Kirche und Land Vorarlberg und Österreich über alle Jahrzehnte hinweg verbunden und bin dankbar für all die Rückendeckung, die ich seit 60 Jahren erhielt und immer noch erhalte. Aber meine Lebensaufgabe, zunächst als Priester und dann seit 1981 als Bischof, versuche ich hier zu erfüllen.
Wie sehen Sie Ihr Wirken in Brasilien? Was hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
Bischof Kräutler: Seit meiner Ankunft hier ist mein Leben ein fortwährender Lernprozess. Ich musste nicht nur die portugiesische Sprache (und später auch indigene Sprachen) erlernen, sondern mich in die kulturellen Eigenarten des Volkes „einfühlen“. Ich musste lernen, zu denken, wie die Leute denken, wie sie empfinden, wie sie lieben und leiden. Ich bin bis heute ein Lernender. Anfangs war es gar nicht einfach, denn ich kam ja, beinahe noch als „Primiziant“ hier an den Xingu mit allem, was damals ein junger Priester für Ideen und Pläne hatte. Ich lebte in meinen Salzburger Jahren an der Theologischen Fakultät im Dunstkreis des II. Vatikanischen Konzils mit der freudigen und feurigen Stimmung eines neuen kirchlichen Frühlings, eines neuen Pfingsten, die uns alle erfüllte und begeisterte. Gott sei Dank erkannte ich rasch, dass ich hier nicht „Lehrer“, sondern „Schüler“ war und bei allem Enthusiasmus, eine neue Weise Kirche-zu-sein verwirklichen zu helfen, Etappen nicht überspringen darf. Ich musste lernen, auf die Leute zu hören und ihre Gangart zu respektieren.
Als ich dann im November 1980 zum Bischof ernannt wurde, hatte ich bereits 15 Jahre Erfahrung und konnte versuchen, mit dem Volk Gottes, im Sinne der Lateinamerikanischen Bischofskonferenzen von Medellin (1968) und Puebla (1979), neue Wege zu finden. Wir haben bereits 1984 die „Erste Versammlung des Volkes Gottes am Xingu“ ausgerichtet, mit etwa 800 von den kirchlichen Basisgemeinden am Xingu gewählten Vertreter:innen. Diese Erfahrung ist mir bis heute unvergesslich. Sie wiederholte sich nachher alle fünf Jahre! Wir erlebten jedes Mal pur das, was man nun wieder Synodalität nennt, denn alle zusammen, gemeinsam, heute würden wir sagen synodalisch, erarbeiteten und beschlossen wir, nach einer Evaluation der vergangenen, die pastoralen Linien für die folgenden fünf Jahre. Ich schrieb keine Hirtenbriefe. Das Volk Gottes schrieb Herdenbriefe und der Geist des Herrn war stets hautnah spürbar.
In so manchen Kirchen Amazoniens ist seither leider dieses synodale Prinzip von einem neo-hierarchischen Prinzip überschattet worden. Viele neue Bischöfe und junge Priester setzen auf die „alte Disziplin“, manchmal mit pentekostalistischer Ausrichtung, die dem Bischof und den Priestern eine fast uneingeschränkte Leitung des Diözesanlebens überlässt. Kirchliche Basisgemeinden fielen in Misskredit und wurden als „zu politisch“ gebrandmarkt, weil die Leute versuchten, ihren Glauben mit dem Leben in all seinen Dimensionen in Einklang zu bringen. Ein Mitbestimmungsrecht in der Kirche durch das Volk Gottes wurde zurechtgestutzt. Es bleibt zu hoffen, dass die „Synode zur Synodalität“ nun doch eine Neubesinnung bewirkt und den, bei den Lateinamerikanischen Bischofskonferenzen beschlossenen Optionen wieder neuen „synodalischen“ Schwung verleiht, wie wir es so lange gewohnt waren und erleben durften.
Sie haben sich jahrzehntelang, oft unter lebensbedrohlichen Umständen, für gerechtere Arbeitsbedingungen für die Menschen in Brasilien und für den Schutz der Umwelt eingesetzt. Was hat Ihnen immer wieder Mut gemacht, nicht aufzugeben?
Bischof Kräutler: Ich denke da besonders an den Einsatz für die Indigenen Völker Amazoniens und unsere Mit-Welt. Der Begriff „Mit-Welt“ scheint mir viel angebrachter als das anonym anmutende Wort „Umwelt“. Mit-Welt bedeutet, dass wir Menschen dazu gehören, ein Teil dieser Welt sind und für sie Verantwortung tragen.
Ich war 17 Jahre lang Vorsitzender des Indigenen Rates der brasilianischen Bischofskonferenz. Beim Verfassungsgebenden Nationalkongress 1987/88 haben wir die Rechte der Indigenen Völker in die brasilianische Bundesverfassung gebracht, das Recht auf ihr angestammtes Land, auf ihre Sprache und ihre kulturellen und sozialen Ausdrucksformen. Bis heute setzen wir uns für Respekt den Indigenen gegenüber und die Achtung ihrer Rechte ein. Sie sind mir ein besonderes Anliegen und ich melde mich immer wieder zu Wort, wenn es um die Verteidigung ihrer Rechte geht. Leider macht man sich mit diesem Einsatz nicht nur Freunde, denn für Großgrundbesitzer, Bergwerksgesellschaften, Holzhändler sind die Indigenen seit eh und je ein Hindernis für ihre unersättliche Gier, die Naturreichtümer und Bodenschätze Amazoniens an sich zu reißen, ohne Rücksicht auf die indigenen Gemeinschaften. Wir sind in unserem kirchlichen Auftrag nicht nur „für“ die Indigenen da, sondern kämpfen „mit“ ihnen, an ihrer Seite, für ihre Rechte.
Amazonien, wie ich es 1965 antraf, gibt es nicht mehr. In den vergangenen Jahrzehnten wurde unsäglicher Raubbau betrieben und wir spüren heute bereits die Folgen der Entwaldung und Brandrodung. Die Temperaturen am Xingu sind in der Trockenzeit um Grade angestiegen. Kleinere Flüsse und Nebenflüsse, die immer Wasser führten, trocknen aus und Fische verenden. Selbst der Xingu, ein in normalen Zeiten unendlich wasserreicher Fluss, wird in der Trockenzeit teilweise seicht und die damit verbundene erhöhte Wassertemperatur bewirkt das Fischsterben. Wir weisen immer wieder auf unsere Verantwortung den zukünftigen Generationen gegenüber hin, um der Zerstörungswut Einhalt zu gebieten. Die Amazonas-Synode im Oktober 2019 im Vatikan, an der alle Bischöfe vom internationalen Amazonien teilnahmen, hat viel dazu beigetragen, dass wir uns als Kirche auch zum Sprachrohr der gemarterten Schöpfung machen.
Wie unterscheiden sich Christen und Katholiken in Brasilien im Vergleich zu Österreich bzw. Vorarlberg?
Bischof Kräutler: Ich mache nicht gerne Vergleiche. Jedes Land hat seine eigene Geschichte, seine Kultur, Sprachen und Traditionen. Im Vergleich zu Europa ist unsere Kirche immer noch „jung“. Vergleiche sind meist, individuell bedingt, einseitig und meist auch oberflächlich. Ich denke, unsere Kirche hat in jedem Land ihre Schönheit, aber auch ihre besonderen Sorgen und Nöte. Sie muss die „Zeichen der Zeit“ erkennen und sich den Herausforderungen ihrer Realität stellen.
Sie wurden vor 60 Jahren zum Priester geweiht.
Wie haben Sie diesen wichtigen Wendepunkt in Ihrem Leben in Erinnerung?
Bischof Kräutler: Natürlich ist die Erinnerung an meine Priesterweihe fest in meinem Gedächtnis verankert als „die Stunde“ schlechthin in meinem Leben, die meine Lebensgeschichte unwiderruflich in ein „Vorher und Nachher“ geteilt hat. Die Priesterweihe war für mich irgendwie tiefgreifender als die Bischofsweihe am 25. Jänner 1981 in Altamira, denn für das Priestertum habe ich mich selbst „entschieden“. Zum Bischof wurde ich vom Papst „ernannt“ und die Bischofsweihe war die Folge dieser Ernennung.
Im letzten Konzilsjahr, 1965, waren die Weihehandlungen noch nach dem vorkonziliaren Ritus. Das neue „Pontificale Romanum“ kam ja erst 1971 als Frucht des Konzils heraus. Der erste Schritt zur Weihe war die „Tonsur“, die ich mit den damaligen Kollegen meiner Gemeinschaft der Missionare vom Kostbaren Blut und vom Priesterseminar in der erzbischöflichen Hauskapelle in Salzburg erhielt. Es wurde uns am Scheitel ein Fünf-Schilling-großes Glätzchen herausgeschnitten, sodass später, als ich wieder einmal zum Friseur ging, eine Friseurin mich fragte, ob ich wohl einen „Unfall“ mit einer Kopfverletzung erlitten habe. Nachher kamen die sogenannten Niederen Weihen (Ostiarier, Lektor, Exorzist und Akolyth) und schließlich spendete uns am 16. Dezember 1964 der damalige Salzburger Weihbischof Eduard Macheiner (später Erzbischof, +1972) im Kolleg unserer Kongregation St. Josef in Salzburg-Aigen die Subdiakonatsweihe. Ich schrieb damals in mein Tagebuch einen Vers aus Grillparzers "Medea": „Der Tag bricht an, mit ihm ein neues Leben…“. Vor dieser Weihe war eine handschriftliche Zölibatserklärung zu verfassen und dem Ordensoberen oder Rektor des Priesterseminars zu übergeben. Mit dieser Weihe begann auch die Verpflichtung zum täglichen Breviergebet, das ich bis heute mit Freude und viel persönlichem Gewinn verrichte, insbesondere nach der Reform der Gebetszeiten, die uns nun in einem Zwei-Jahres-Zyklus die gesamte Heilige Schrift zur Meditation anbietet.
Die Diakonatsweihe folgte zwei Tage später durch denselben Weihbischof, am frühen, eiskalten Wintermorgen des 18. Dezember 1964 in der altehrwürdigen Erzarbteikirche St. Peter in Salzburg.
Die Priesterweihe spendete uns am 3. Juli 1965 der damalige Erzbischof und 85. Nachfolger des Hl. Rupert, Andreas Rohracher (+ 1976) im Dom zu Salzburg. Wir waren zwölf Diakone. Ich schrieb am Vorabend der Weihe in mein Tagebuch: „... ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst“ (Joh 21,18) und dazu noch aus der Apostelgeschichte die Worte: „und ich werde ihm zeigen, wieviel er, um meines Namens willen zu leiden haben wird“ (Apg 9,16). Ich mache mir bis heute absolut keinen Reim darauf, warum mich damals gerade diese Schriftstellen so tief berührt hatten. Und verblüffend ist, wie sie sich im Laufe meines Lebens dann auch eindeutig erfüllt haben. Die Inschrift am Hochaltar des Salzburger Doms ist mir immer in Erinnerung geblieben: "Notas Fecisti Mihi Vias Vitae" (Du hast mir die Wege des Lebens kundgetan, Psalm 15,10). Selbstverständlich war damals der gesamte Weiheritus noch in lateinischer Sprache und einer der Höhepunkte der Zeremonien nach der Handauflegung war immer der von der Schola im gregorianischen Choral angestimmte Vers aus dem Johannesevangelium „Iam non dico vos servos, quia servus nescit quid facit dominus eius; vos autem dixi amicos, quia omnia, quae audivi a Patre meo, nota feci vobis” („Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe“ Joh 15,15).
Am 18. Juli 1965 feierte ich mit meiner Heimatgemeinde Koblach in der renovierten Pfarrkirche St. Kilian die Erste Heilige Messe am neu erstellten Volksaltar „versus populum“ (zum Volk gerichtet), damals noch etwas Außergewöhnliches. Ein Triduum, geleitet von Dekan Roman Amann (auch ein Koblacher + 2011), stimmte die Pfarrgemeinde auf die Primiz ein. Mein lieber guter Heimatpfarrer Alfred Bildstein (+ 1970) war „Presbyter Assistens“ und mein Onkel Erich (+ 1985) hielt die Predigt auf seine berühmt feurige Art. Diakon war ein Verwandter meiner Familie, der langjährige Dekan Liechtensteins im Bistum Chur, Franz Näscher und Subdiakon mein Mitbruder und spätere Provinzial Pater Josef Epping (+ 1994). Der Kirchenchor sang die „Missa pro Patria“ von Johann Baptist Hilber und Theologen des Priesterseminars in Innsbruck (unter ihnen auch Josef "Joe" Egle) sangen die Zwischengesänge mehrstimmig und ergreifend nach der byzantinischen Chrysostomus-Melodie. P. Josef Gehrer, auch Koblacher und damals noch Student, fertigte eine Tonbandaufnahme an, ein Novum bei einer Primiz.
Am 2. November 1965, am Geburtstag meines Vaters, nahm ich Abschied von meiner Familie und Heimatgemeinde und bestieg am 4. November in Hamburg das Frachtschiff der Norddeutschen Lloyd „Emsstein“, das mich nach drei Wochen auf Hoher See am 25. November nach Belém, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Pará, brachte. Am 21. Dezember 1965 kam ich in Altamira am Xingu an. Gott Lob und Dank!
Papst Franziskus war Argentinier, Papst Leo XIV wirkte viele Jahre in Peru. Sind diese beiden Päpste wichtig für die Entwicklung des Christentums in Südamerika?
Bischof Kräutler: Nicht nur für Süd- oder Lateinamerika, sondern für die gesamte „katholische“ d. h. weltumspannende, in allen Kulturen, Sprachen und Kontinenten realisierbare Kirche unseres Herrn Jesus! Im nachsynodalen Apostolischen Schreiben zur Panamazonischen Synode, „Querida Amazônia“, sprach Papst Franziskus von vier Visionen: einer „sozialen Vision“, einer „kulturellen Vision“, einer „ökologischen Vision“ und einer „kirchliche Vision“. In der „kirchlichen Vision“ nannte er als „echte Erfahrungen von Synodalität auf dem Weg der Evangelisierung der Kirche in Amazonien“ die „Basisgemeinden, die die Verteidigung sozialer Rechte mit missionarischer Verkündigung und Spiritualität zu verbinden wussten“. Und weiter: „Viele ihrer Mitglieder haben sogar ihr Leben dafür hingegeben.“ (QA Nr. 96).
Was das Pontifikat von Papst Franziskus jedoch außerordentlich prägte, war die Synode: „Für eine synodale Kirche – Gemeinschaft, Teilhabe, Mission“. Diese Synode ist aus zwei Gründen symbolträchtig:
• Sie war bis heute die längste Synode, begann im Oktober 2021 in den Ortskirchen, durchlief dann eine nationale und kontinentale Phase und gipfelte schließlich in der zweifachen Vollversammlung im Oktober 2023 und Oktober 2024 im Vatikan und will erst 2028 mit einer weltumspannenden Versammlung des Volkes Gottes einen Abschluss finden.
• Das erste Mal in der Kirchengeschichte (abgesehen von der Urkirche) hatten Laien Stimmrecht. Wir von Amazonien hatten dies bei der Panamazonischen Synode 2019 bereits eindringlich, aber leider noch erfolglos gefordert.
Das Abschlussdokument, das Papst Franziskus am 26. Oktober 2014 verabschiedete, „nimmt am ordentlichen Lehramt des Nachfolgers Petri teil, und als solches bitte ich um dessen Annahme“ schrieb Franziskus. In Bezug auf „indigene Völker“ und „Schöpfung“ nennt das Abschlussdokument bereits als Ausgangspunkt die Bitte um „Vergebung unserer Sünden. Wir schämen uns und treten für die Opfer des Bösen in der Welt ein. Wir benennen unsere Sünden beim Namen: gegen den Frieden, die Schöpfung, indigene Völker, Migranten, Kinder, Frauen, die Armen, das Zuhören, die Gemeinschaft. Dies hat uns verstehen lassen, dass Synodalität tatsächlich zuerst Reue und Umkehr erfordert“ (vgl. Nr. 6).
Der Erzbischof vom Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, den ich schon, bevor er Papst Franziskus wurde, persönlich kannte, war für uns in Amazonien wie „der Engel des Herrn“, der nun die schon Jahrhunderte alten Sorgen und Anliegen der Kirche in Amazonien beim Namen nannte und uns aufrief, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz, „con mucha coraje“ das Evangelium in Amazonien in amazonischen Ausdrucksformen und Sprachen zu verkünden und, vor allem, zu leben.
Einen wohl bleibenden Eindruck, wer und wie unser neue Papst, Leo XIV, ist, gab mir sein erster Segen „Urbi et Orbi“ und die damit verbundene Ansprache. Er sprach nicht in seiner Muttersprache Englisch, sondern auf Italienisch, der Sprache der Stadt Rom, deren Bischof er nun ist, und wandte sich dann auf Spanisch an das Volk Gottes der peruanischen Diözese Chiclayo. Leo XIV. brachte damit offen die Liebe und Zuneigung zum Ausdruck, die ihn mit den Menschen dieser Region im Nordwesten Perus zwischen Pazifik und Anden verbindet.
Die Worte in Spanisch an das Volk seiner ehemaligen Diözese zeugen von seinem Missionsverständnis. Die „Botschaft“, die wir verkünden muss „inkulturiert“ sein. Und nicht nur die Botschaft, sondern auch der Bote selbst muss sich „inkulturieren“. Von ihm wird die offene und aufrichtige Bereitschaft verlangt, die Menschen, zu denen er gesandt ist, als sein Volk, seine Brüder und Schwestern zu lieben. Das Fürwort „sein“, „mein“ ist niemals „besitzanzeigend“, sondern Ausdruck des Miteinanders. „Lasst euch nicht Rabbi nennen; denn ihr habt einen Meister, und ihr seid alle Brüder und Schwestern“ (vgl. Mt 23,8). Er wird zeitlebens versuchen, die Menschen mit der Liebe zu lieben, mit der Jesus sie liebte und sich bis zum Äußersten hingab. Er wird Jesus verkünden, seine Liebe bezeugen und zum „Knecht“ und zur „Magd“ des Volkes werden, „wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben“ (Mt 20,28).
Robert Francis Prevost lernte die Sprache des Volkes, seine Kultur und die Lebensart seines Volkes kennen. Sein bischöflicher und jetzt auch päpstlicher Wahlspruch weist genau in diese Richtung: „In Illo uno unum“ („In dem Einen sind wir eins“). Diese Worte stammen aus einer Predigt des heiligen Augustinus zu Psalm 127 und verdeutlichen: „Obwohl wir Christen viele sind, sind wir in dem einen Christus eins.“ Um keinen Zweifel daran zu lassen, nahm Robert Francis Prevost die peruanische Staatsbürgerschaft an und fügte in Peru, dem lateinamerikanischen Brauch entsprechend, den Nachnamen seiner Mutter, „Martínez“, zu seinem väterlichen Nachnamen Prevost hinzu. Ad multos annos!
Das Interview führte Ingmar Jochum. Katholische Kirche Vorarlberg, 28.8.2025